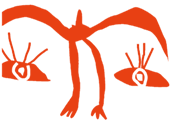Als Reaktion auf den schrecklichen Anschlag am 20. Dezember 2024 auf dem Magdeburger Weihnachtmarkt äußerte sich der CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann in einem Interview mit dem Deutschlandfunk am 30. Dezember 2024: „Wir haben große Raster angelegt für Rechtsextremisten, für Islamisten, aber offenkundig nicht für psychisch kranke Gewalttäter.“ Im weiteren Verlauf des Interviews sagte Linnemann, es reiche nicht aus „Register anzulegen für Rechtsextremisten und Islamisten, sondern in Zukunft sollte das auch für psychisch Kranke gelten.“ (1)
Diese Forderung wurde von Psychiatrie-Organisationen und Experten zurückgewiesen. Wenige Wochen später tötete ein ausreisepflichtiger Asylbewerber aus Afghanistan in Aschaffenburg zwei Menschen. Gegen den Mann liefen Strafverfahren und er war mehrfach wegen psychischer Ausnahmesituationen zwangsweise in der Psychiatrie untergebracht worden. In der Diskussion über beide Fälle werden Extremismus/Terrorismus und vermeintliche psychische Erkrankungen – bei dem Täter von Magdeburg ist noch nicht einmal klar, ob er psychisch krank ist – häufig miteinander verknüpft.
Darauf reagierte u.a. die Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde (DGPPN) Prof. Dr. Euphrosyne Gouzoulis-Mayfrank am 7.1.2025 in einer Pressemitteilung: „Psychische Erkrankungen sind generell nicht mit einem erhöhten Gewaltrisiko verknüpft. Nur bestimmte Erkrankungen gehen mit einem erhöhten Risiko für Gewalttaten einher und das auch nur unter bestimmten Bedingungen und wenn die Betroffenen unbehandelt sind. Eine zentrale Erfassung aller Menschen mit einer psychischen Diagnose würde Gewalttaten nicht verhindern.“ (2) Die zentrale Register-Erfassung würde vielmehr, so Gouzoulis-Mayfrank, die Stigmatisierung psychischer Erkrankungen befördern und die Chancen auf wirksame Behandlungen senken. Auch die Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychiatrie (DGSP) hält in einer Stellungnahme am 24.1.2025 (3) fest, dass psychisch erkrankte Menschen nicht per se Zielscheibe gesellschaftlicher Popularisierung – gemeint ist wohl Populismus – und Stigmatisierung sein dürfen. Die DGSP verweist in diesem Zusammenhang auch auf die Tragweite des Register-Vorschlags vor dem Hintergrund des 80. Jahrestags der Befreiung vom Nationalsozialismus.
Mit dem Blick in die Psychiatriegeschichte kann dies nur unterstrichen werden. Bereits in der Weimarer Republik wurden psychisch erkrankte Menschen registriert. In Leipzig wurde ab 1920 ein System der Außenfürsorge/Offene Fürsorge aufgebaut. Dieser seinerzeit als innovativ betrachtete Ansatz sollte der besseren Nachbetreuung entlassener Anstaltspatientinnen und -patienten, ihrer Beratung und Förderung in gesundheitspolitischer und sozialer Hinsicht dienen. Doch nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten wurde die Außenfürsorge zu einem Instrument der Erfassung vermeintlich Erbkranker, die zunächst mittels des „Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ zwangssterilisiert und dann im Rahmen der „Euthanasie“ ermordet wurden.
Der Vorschlag Linnemanns ist übrigens nicht neu. Im Entwurf zum Bayrischen Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz 2018 war vorgesehen, dass die Daten sämtlicher zwangsweise in der Psychiatrie untergebrachter Patientinnen und Patienten an eine Zentralstelle weitergegeben und in einer Unterbringungsdatei mindestens fünf Jahre gespeichert werden.
Erfasst werden sollten u.a. Informationen zur Diagnose, dem Befund und der Therapie. Andere Behörden wie Verwaltung, Sicherheit und Justiz hätten Zugang zu dieser Datei gehabt. Erst nach dem Widerstand der Opposition in Bayern und Protesten von Psychiatern, Verbänden und Datenschützern wurde auf die Einführung dieser Zentraldatei verzichtet. (4)
Angesichts einer immer stärker werdenden AfD, aus deren Reihen Äußerungen kommen, die beispielsweise die schulische Inklusion als ein „Ideologieprojekt“ bezeichnen, von dem man das Bildungssystem befreien müsse (Björn Höcke im mdr-Sommerinterview 2023), kann man die Sorge von Behindertenverbänden verstehen, dass Menschen ausgegrenzt werden sollen und damit auch ein Nährboden für die Stigmatisierung sowohl von Migrantinnen und Migranten als auch psychisch erkrankten Menschen geschaffen wird.
Dazu wurde Georg Schomerus, Direktor der Uniklinik für Psychiatrie, in einem Spiegel-Interview am 6.2.2025 (5) befragt. Darin äußert sich Schomerus u.a. zu der Forderung nach einem Register: „Das wäre fatal! Solche Register würden nur das Risiko für Gewalttaten vergrößern. Ja, gewalttätige Impulse oder Gedanken können Symptom einer schweren psychischen Krankheit sein, das ist selten. Solche Symptome fallen aber nicht vom Himmel, sie entwickeln sich. Um zu verhindern, dass daraus Gewalttaten werden, müssen Erkrankte darüber in der Behandlung sprechen können! Wer aber weiß, dass es im Hintergrund ein Register gibt, wer fürchten muss, auf solchen Listen zu landen und polizeibekannt zu werden, wird mir als Psychiater wohl kaum von seinen Gewaltgedanken und -fantasien berichten.“ Das bei Menschen mit Psychosen in der Langzeitbetrachtung und unter bestimmten Umständen erhöhte Gewaltrisiko ließe sich, so Schomerus, vor allem durch gute Behandlung minimieren. Es brauche Vertrauen und Zuwendung, nicht Abgrenzung. „Die allermeisten Menschen mit dieser Diagnose haben überhaupt nichts mit Gewalt zu tun und wenn, werden sie viel häufiger Opfer als Täter.“
Im Hinblick auf die psychiatrische Versorgung von Asylbewerbern verweist Georg Schomerus darauf, dass die Bundesmittel für psychosoziale Hilfe für Geflüchtete fast halbiert wurden und gerade einmal drei bis vier Prozent der Hilfsbedürftigen die nötige Hilfe erhalten.
Auf die Frage, wie sich die Stigmatisierung psychisch Erkrankter und Asylsuchender gesellschaftlich überwinden lasse, antwortet Georg Schomerus: „Kurz gesagt, sollten wir vor allem nicht über diese Gruppen sprechen, sondern mit ihnen. Menschen mit schweren psychischen Krankheiten müssen sichtbar und hörbar sein, genauso wie Menschen mit Migrationserfahrung. Denn in diesen Geschichten liegt auch viel Stärke, viel Erfahrung im Umgang mit Krisen. Davon können wir alle profitieren.“
Statt Menschen in Registern zu erfassen, sind Toleranz, Akzeptanz und ihre soziale, medizinische und therapeutische Unterstützung die beste Prävention!
Thomas R. Müller
Literatur:
(1) www.zdf.de
(3) Stellungnahme-zur-registrierung-psychisch-erkrankter-menschen
(4) Massive Kritik an-geplantem Psychiatriegesetz in Bayern;
Betroffenen-Positionspapier-PsychKHG-BayPE.pdf
Plenum Bayrischer Landtag zum Psychisch-Kranken-Hilfegesetz
(5) www.spiegel.de
24. 03. 2025