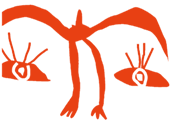Wieso kämpfe ich Tag für Tag?
Wofür das alles? Es ist sinnlos. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich habe eigentlich keine Kraft. Keine Lust, auch keine Unlust, es ist mir irgendwie gleich. Also mache ich jetzt trotzdem wieder weiter wie immer oder darf ich mich auch einfach mal hängen lassen? Lustlosigkeit und Gleichgültigkeit begleiten mich Tag für Tag. Wirklich alles fühlt sich sinnlos an, auch meine eigene Daseinsberechtigung. Es ist absurd, wenn ich darüber nachdenke, aber so fühlt es sich an. Meinen mangelnden Antrieb kompensiere ich durch sinnstiftende, zielgerichtete, zweckgebundene Tätigkeiten, weil nur die mich motivieren. Wenn ich sinnvolle Tätigkeiten vorhabe, dann ist das ein guter Grund aufzustehen. Wenn ich das Altglas dabei wegbringen kann, dann ist ein guter Grund spazieren zu gehen. So ungefähr. Sinnstiftende Aufgaben zu bewältigen schützt mein Selbstwertgefühl vor dem Absaufen. Ich habe dann das Gefühl, dass ich etwas geschafft habe. In diesem ewigen Spannungsverhältnis zwischen Sinnlosigkeit und Sinnsuche komme ich so durch den Tag. Ich bleibe am Laufen. Immer auf der Suche nach der nächsten Portion Dopamin oder Serotonin. Gute Gesellschaft, Kochen, Yoga, Gärtnern, Tanzen, Schreiben, Musik und vieles mehr können mich in einen Flow versetzen oder mindestens gut ablenken. Dabei muss ich aber auch aufpassen, dass ich damit nicht übertreibe. Manchmal springe ich auf die Tätigkeit einfach nicht an, dann bringt sie mir nichts. Oder wenn ich sie zu oft mache, lässt die Wirkung womöglich nach. Und die Dosis macht das Gift. Es gab Zeiten, da musste ich ein Maß finden, um mich nicht mit einer Essstörung zugrunde zu richten. Ich musste kreativ werden und mir meinen Erfahrungsschatz mehr mühsam als müßig erarbeiten.
Schuldgefühle
Gefühle der Minderwertigkeit, Schuld und Angst vor Ablehnung begleiten mich seit meiner Kindheit. Irgendwann spürte ich ständig dieses diffuse Gefühl, nicht gut genug zu sein und besser sein zu müssen. Dafür fand ich damals noch keine Worte, zumal in meiner Familie Gefühle und Konflikte unter den Teppich gekehrt wurden. Überanpassung, Leistungsbereitschaft bis hin zu Perfektionismus waren meine frühen Antworten auf meine Gefühlswelt. In der Familie, in der Schule und überhaupt wurde ich die Fleißige, die Vernünftige, die Hilfsbereite, die Umgängliche. Am besten noch schlank und hübsch, dachte sich mein pummeliges Kind-Ich. Bloß keinen Ärger machen. Keinen Streit anfangen. Keine Ecken und Kanten zeigen. Bloß nichts tun, was mein tiefes Schuldgefühl triggern und beweisen könnte, dass ich ungenügend bin. Denn das glaubte ich ja irgendwie tief und fest. In meiner Pubertät übertrug ich den Perfektionismus auch auf mein Essverhalten und lebte mein Bedürfnis nach Ordnung, Sicherheit und Kontrolle durch die Beschäftigung mit Essen aus. Ein Teufelskreis aus Essen und Hungern zugleich. Ich funktionierte wie ein Roboter. Innerlich war ich sozial isoliert, in meiner eigenen Welt, in der Ordnung herrschte. Alles, was ich tat, überdachte und kontrollierte ich grundsätzlich im Voraus. Big Brother is watching you im eigenen Kopf. Langsam bekam ich aber auch eine Ahnung, dass ich mit meinem Essverhalten irgendwie nicht ‚normal‘ war, was mein Scham- und Schuldgefühl verstärkte. Ich lernte also, die Magersucht so zu drosseln, dass ich damit anderen nicht mehr auffiel. Und dass ich zu Hause so zielstrebig und viel für die Schule arbeitete, wurde in der Familie und Schule gelobt, vielleicht mal von Geschwistern aufs Korn genommen, in jedem Fall aber toleriert. Also gab es keinen Grund etwas daran zu ändern und ich funktionierte so weiter vor mich hin. Die Schule hatte in meiner Jugend Priorität. Meine Schwestern und Gleichaltrige tickten da natürlich anders. Von Aufblühen in der Schule konnte aber nicht die Rede sein. Ich hielt mich mit meiner Präsenz im Unterricht zurück. Hauptsache nicht negativ auffallen, das war mein Motto. Immer an die Regeln halten. Und mit möglichst guten Noten glänzen.
Perfektionismus
Der Perfektionismus funktionierte im Erwachsenenalter zunehmend schlechter und ließ mich ausgelaugt und erschöpft zurück. Bereits zu Beginn meiner Studienzeit kam die erste depressive Episode, die mich ziemlich außer Gefecht setzte. In der Anonymität der Uni fiel ich damit aber nicht auf. Es wusste ja kaum jemand, dass ich gar nicht mehr in Vollzeit studiere, dass ich zum zweiten Mal das Fach gewechselt und eine Psychotherapie angefangen habe. Aus meinem gewohnten Perfektionismus heraus tat ich alles, um möglichst weiter zu funktionieren und nicht negativ aufzufallen. Die ambulante Psychotherapie sollte mich wieder gesund und leistungsfähig machen. Eine zweite Therapie folgte einige Jahre später, weil irgendwie immer noch nicht alles in Ordnung war. Jetzt bin ich 30, mitten in einer nicht enden wollenden Berufsfindungskrise und erhole mich von einer zweiten, schweren depressiven Episode. Die war eingetreten, nachdem ich zum zweiten Mal nach wenigen Monaten sozialpädagogischer Berufstätigkeit gekündigt hatte, weil
ich nicht mehr konnte. Auf der Arbeit hatte ich viel Verantwortung getragen und war von der altbekannten Angst geplagt worden, mich irgendwie schuldig zu machen. Also versuchte ich allen und allem gerecht zu werden und brach unter dem Druck zusammen.
Das Gefühl versagt zu haben, trieb mein Schuldgefühl in unerträgliche Höhen. Da ließ ich zum ersten Mal sowohl meine diffusen Depressionen und Ängste als auch meine neu entflammte Essstörung stationär behandeln. Das war dann der Startschuss dafür, meine Krankheitssymptome als solche zu erkennen, zu akzeptieren und mich von der Schuld an meiner eigenen Krankheit zu befreien. Das ist aber ein Prozess, der da erst begonnen hat. Meine ersten Angst- oder Panikattacken habe ich nun retrospektiv als solche erkannt. Meine dauerpräsenten Kopf- und Nackenschmerzen, die Bauchschmerzen, das Schwächegefühl, die Atembeklemmung habe ich nun als Angst- und Stresssymptome begriffen. Die Macht und Chronifizierung meiner Essstörung wurde mir bewusst. Und die Gefühle der inneren Leere und Sinnlosigkeit, mein ständiger Drang seit meiner Jugend meinem Leben mehr Sinn zu geben, all das und viel mehr begann ich endlich überhaupt erst zu beachten.
unsichtbare Krankheiten
Depressionen, Angststörungen und Essstörungen sind für die Laien oft unsichtbare Krankheiten. Dabei ist die Unsichtbarkeit auch Teil der Krankheit. Ich will sie sichtbar machen, weil Scham- und Schuldgefühl, Angst vor Ablehnung und soziale Isolation sich sonst verstärken und das alles nur noch schlimmer machen kann. Ich will diese Erkrankungen auch deshalb sichtbar machen, weil ich meine persönlichen, alltäglichen Leistungen im Umgang mit meiner depressiven und ängstlichen
Gefühlswelt gewürdigt wissen will. Angststörung bedeutet nicht nur, ständig Angst zu haben, sondern eben ständig in der Konfrontation zu sein und zu entscheiden, ob ich mich der Gefahr jetzt stelle oder nicht. Ständig mit der Angst zu ringen ist ein ständiger Kampf. Die Erschöpfung von all der Anstrengung lässt mich manchmal zweifeln. Warum strenge ich mich jeden Tag so an? Warum konfrontiere ich mich immer wieder in sozialen Situationen? Warum fange ich neue Jobs und Projekte an, wenn ich gar nicht das Selbstvertrauen geschweige denn Lust darauf habe? Es ist wie Sisyphusarbeit. Ich drehe mich im Kreis. Die depressiven Empfindungen bleiben. Depression ist ein Warnsignal des Körpers, dass etwas schief läuft, und ein Hilfeschrei nach Veränderung und einem besseren Leben. Menschen mit Depressionen sind mit der existenziellen Sinnfrage des Lebens besonders konfrontiert. Was macht mein Leben wieder lebenswert? Was schenkt mir Energie? Was macht mich wieder lebendig? Was finde ich schön in der Welt? Für mich sind das ganz alltägliche Fragen, die mich dazu nötigen ein sehr bewusstes Leben zu führen.
Das Recht psychisch krank zu sein
Wo bleiben Mitgefühl und Verständnis für das, was Betroffene täglich erleben? Mitgefühl und Verständnis, das wir uns eigentlich nicht erst verdienen müssen. Wenn ich mich durch und durch so fühle, darf ich mich nicht auch einfach mal hängen lassen? Wer hat das Recht, mir zu verbieten, die Gefühle zu haben und auszudrücken, die ich eben gerade habe? Und wo bleibt auch die Anerkennung für den alltäglichen Kampf und die erlernten Kompetenzen im Umgang mit dem depressiven Dauerstress? Möglicherweise auch für die erarbeiteten Mittel und Wege, um Krisen konstruktiv zu bewältigen und das eigene Leben umzukrempeln? Vielmehr herrscht das Vorurteil und Missverständnis, dass Menschen mit Depressionen zu faul oder zu schwach oder zu unfähig zum Leben sind. Depression ist eine Erkrankung, die sich niemand aussucht. Krankheit ist ein Weg und manche Menschen müssen diesen Weg einfach gehen. Betroffene haben das Recht, so psychisch krank zu sein, wie sie nun einmal gerade sind. Psychische Erkrankungen müssen beachtet werden, bevor sie heilen können. Und Betroffene haben das Recht auf Heilung. Wir treten ja auch nicht jemandem gegen das gebrochene Bein. Das wäre zynisch. Menschen mit Depressionen sind in ihrem Selbstwertgefühl und ihrem Vertrauen in positive soziale Erfahrungen und Beziehungen ohnehin tief verletzt. Da können sie die Vorurteile und Verachtung von anderen erst recht nicht gebrauchen. Sie gehören genauso in die Gesellschaft wie alle anderen auch. Wir müssen unseren Wert nicht an unserer Funktionalität messen. Und wo bleibt vielleicht auch die Anerkennung für Menschen, die sich mit den existenziellen Fragen des Lebens und Menschseins auseinandersetzen – die über den Tellerrand und das Hamsterrad hinaus denken und leben? Vielleicht haben Sie uns etwas Wichtiges zu sagen?
Das ist eine verrückte Welt. Im Bildungssystem und in der Arbeitswelt werden Perfektionismus und Selbstausbeutung meistens belohnt und verstärkt, während für die Befindlichkeiten und das Wohlergehen der Menschen kein Raum ist. Die Gesellschaft verachtet psychische Erkrankungen, die sie selbst mit hervorbringt. Betroffene müssen ihre Befindlichkeiten verstecken und sich dafür schämen. Sie müssen sich am herrschenden Ideal ungebrochener Leistungsfähigkeit und
vermeintlicher Stärke messen und sich minderwertig fühlen. Ich bin das alles leid. Ich will, dass Betroffenen endlich der Respekt entgegengebracht wird, der ihnen zusteht. Dass ihnen mit Achtung begegnet und zugehört wird. Dass sie mit ihrem Schmerz, ihrem Kampf, ihren Leistungen und ihrer wahren Stärke gesehen werden, damit sie sich auch selbst mehr achten können.
Anastasia W. – AG Vorurteilsfrei
Depressionen, Angststörungen und Essstörungen sind für die Laien oft unsichtbare Krankheiten. Dabei ist die Unsichtbarkeit auch Teil der Krankheit. Ich will sie sichtbar machen, weil Scham- und Schuldgefühl, Angst vor Ablehnung und soziale Isolation sich sonst verstärken und das alles nur noch schlimmer machen kann.
25.09.2021